Naturschutzgebiet – dabei denken wir an einen Rückzugsort für Tiere und Pflanzen, fernab menschlicher Eingriffe. Doch wie effektiv sind diese Gebiete wirklich? Wie viel Fläche ist tatsächlich geschützt – und wie konsequent?
Was sind Naturschutzgebiete – und was sollen sie leisten?
Der Begriff „Naturschutzgebiet“ ruft bei vielen das Bild von unberührter Natur hervor: dichte Wälder, artenreiche Wiesen, seltene Tiere – und das alles geschützt vor menschlichem Einfluss. Die Idee dahinter: bestimmte Flächen der Natur zu überlassen, damit sich dort Lebensräume möglichst ungestört entwickeln können.
Doch die Realität sieht oft anders aus. Wir werfen daher einen kritischen Blick auf Deutschlands Naturschutzgebiete (NSG) – sind sie das, was sie versprechen zu sein?
Key Facts: Naturschutzgebiete in Deutschland
• Anteil an der Landesfläche: Nur 4,1 % Deutschlands sind als Naturschutzgebiet (NSG) ausgewiesen
• Anzahl: Rund 9.000 NSG gibt es bundesweit
• Größe: fast 60 % der NSG sind kleiner als 50 Hektar
• Eines der ältesten NSG: Lüneburger Heide, als Naturschutzgebiet ausgewiesen 1921
Diese Zahlen zeigen: Der Naturschutz in Deutschland ist fragmentiert. Kleine, isolierte Schutzflächen machen es schwer, zusammenhängende Lebensräume zu erhalten – ein Problem, das angesichts von Klimawandel, Artensterben und intensiver Landnutzung immer drängender wird.
Schutz auf dem Papier – aber auch in der Praxis?
In vielen Naturschutzgebieten dürfen befestigte Wege nicht verlassen werden – aus gutem Grund: Besuchende sollen sensible Lebensräume nicht stören. Gleichzeitig fahren tonnenschwere Holzerntemaschinen in Schutzwälder, um Bäume zu fällen.
Ein Beispiel gefällig? Im Lampertstal in der Eifel, oft als „Toskana der Eifel“ bezeichnet, sollen eigentlich wertvolle Buchenwälder geschützt werden – darunter wertvolle Waldflächen mit 180 Jahre alten Buchen. Doch genau diese Wälder wurden und werden eingeschlagen, mit dem Ziel, den Bestand zu „verjüngen“. Ökologisch betrachtet bleibt dabei oft nur ein besserer Kahlschlag zurück.

Wie kann das in einem Naturschutzgebiet zulässig sein?
Wer sich die Mühe macht, in die jeweilige Naturschutzverordnung zu schauen – zu finden z. B. über die GIS-Portale der Bundesländer oder in den Landschaftsplänen der Landkreise – stößt schnell auf die Antwort: Viele Eingriffe sind dort ausdrücklich erlaubt.
Ein Beispiel sind die sogenannten submediterranen Trockenrasen im Lampertstal, die geschützt werden sollen. Auf den ersten Blick erstaunlich, denn wir befinden uns in der kalten, rauen Eifel. Diese Flächen sind nicht natürlich entstanden, sondern vom Menschen geschaffen – durch jahrhundertelange Übernutzung, bei der Nährstoffe entzogen und nie zurückgegeben wurden. In dieser kargen und daher aufgeheizten Umgebung konnten sich Arten ansiedeln, die unter natürlichen Umständen dort nicht heimisch wären und mit den veränderten, extremeren Bedingungen zurechtkommen.
Schutzgebiete mit Doppelrolle: Natur oder Kulturlandschaft?
Diese Trockenrasen sind vergleichsweise artenreich – deutlich vielfältiger als intensiv genutzte Landwirtschaftsflächen. Doch um diesen Zustand zu erhalten, muss regelmäßig eingegriffen werden: ohne Mahd oder Beweidung würde der Wald zurückkehren. Der „Naturschutz“ besteht hier also darin, natürliche Entwicklung zu verhindern.
Das zeigt: In vielen Fällen sind Naturschutzgebiete eher Kultur- und Landschaftsschutzgebiete. Landwirtschaft und Forstwirtschaft sind nicht nur erlaubt, sondern teilweise sogar notwendig – wenn auch mit Einschränkungen (z. B. angepasste Düngung, Verzicht mancher Pestizide).
Doch stellt sich die Frage: Ist dieser Schutzgedanke im Jahr 2025 noch zeitgemäß?
Ein Gedankenexperiment
Stellen wir uns vor, ein Landwirt in Brasilien rodet gerade eine Regenwaldfläche. Seine Begründung: Er wolle den speziellen Lebensraum, den grasende Rinderherden schaffen, erhalten. Was zunächst zynisch klingt, ist strukturell vergleichbar mit dem, was wir hierzulande vielerorts als „Naturschutz“ bezeichnen.
Der Unterschied: In Deutschland liegt die Rodung der Urwälder Jahrhunderte zurück. In Brasilien passiert sie jetzt.
Ein Schutzgebiet ohne Schutz?
Naturschutzgebiete wie das Lampertstal zeigen, wie schwer es ist, zwischen echtem Naturschutz und pflegeintensivem Museumsbetrieb zu unterscheiden. In bestimmten Fällen kann es sinnvoll sein, alte Kulturlandschaften zu bewahren – etwa als Zeugnis unserer Geschichte oder zur Förderung bestimmter Arten. Diese Gebiete haben durchaus eine Daseinsberechtigung und werden teilweise, wie z.B. in der Lüneburger Heide, auch gut gemanagt.
Aber: Das Label „Naturschutzgebiet“ ist oft irreführend.
Echte Reste alter Natur – wie ursprüngliche Buchenwälder – machen nur Bruchteile von Promille der Landesfläche aus. Und selbst in Schutzgebieten sind sie nicht sicher. Ordnungsgemäße Forst- und Landwirtschaft sind in vielen Naturschutzgebieten erlaubt, die Spielregeln sind oft nicht eng – es hängt stark davon ab, ob die NSG-Verwaltung gut mit Landwirt*innen oder Förster*innen zusammenarbeitet.
Wo ist der Naturschutz, wenn wertvoller Laubwald selbst in Naturschutzgebieten verloren geht, mit all seinen wichtigen Funktionen für Menschen und Lebewesen? Ordnungsgemäße Forstwirtschaft bleibt meist erlaubt und die hat perspektivisch eben keinen Platz für ausreichend alte Bäume und Totholz. Wo aber sollen dann Fledermäuse schlafen? Wo finden Schwarz- und Grauspechte ausreichend dicke Bäume für ihre Höhlen? Wo sollen Käferarten, die ein feucht-kühles Klima und Totholz brauchen, ihre Heimstätten finden?
Wie viel Schutz ist wirklich streng?
Deutschland hat sich verpflichtet, 10 % der Landesfläche unter strengen Schutz zu stellen – im Sinne der EU-Biodiversitätsstrategie. Doch viele der heute bestehenden Naturschutzgebiete erfüllen diese Kriterien nicht.
Wir müssen weitersuchen – nach Flächen, die diesen Namen wirklich verdienen.
Fazit: Naturschutz in Deutschland braucht ein Update
Der kritische Blick auf Deutschlands Naturschutzgebiete zeigt: Vieles ist gut gemeint – aber nicht immer gut gemacht. Echte Wildnis fehlt fast völlig. Stattdessen dominieren gepflegte Kulturlandschaften unter dem Etikett „Naturschutz“.
Wir brauchen:
• Mehr echte Natur in unseren Schutzgebieten
• Weniger Greenwashing durch irreführende Labels
• Klarere gesetzliche Regeln, die Natur wirklich schützen – und nicht nur ihren Anschein
• Mut, alte Denkweisen zu hinterfragen, auch wenn sie sich jahrzehntelang etabliert haben
Nur dann werden Schutzgebiete ihrer eigentlichen Aufgabe gerecht: der Erhaltung echter biologischer Vielfalt, und damit unserer Lebensgrundlage.

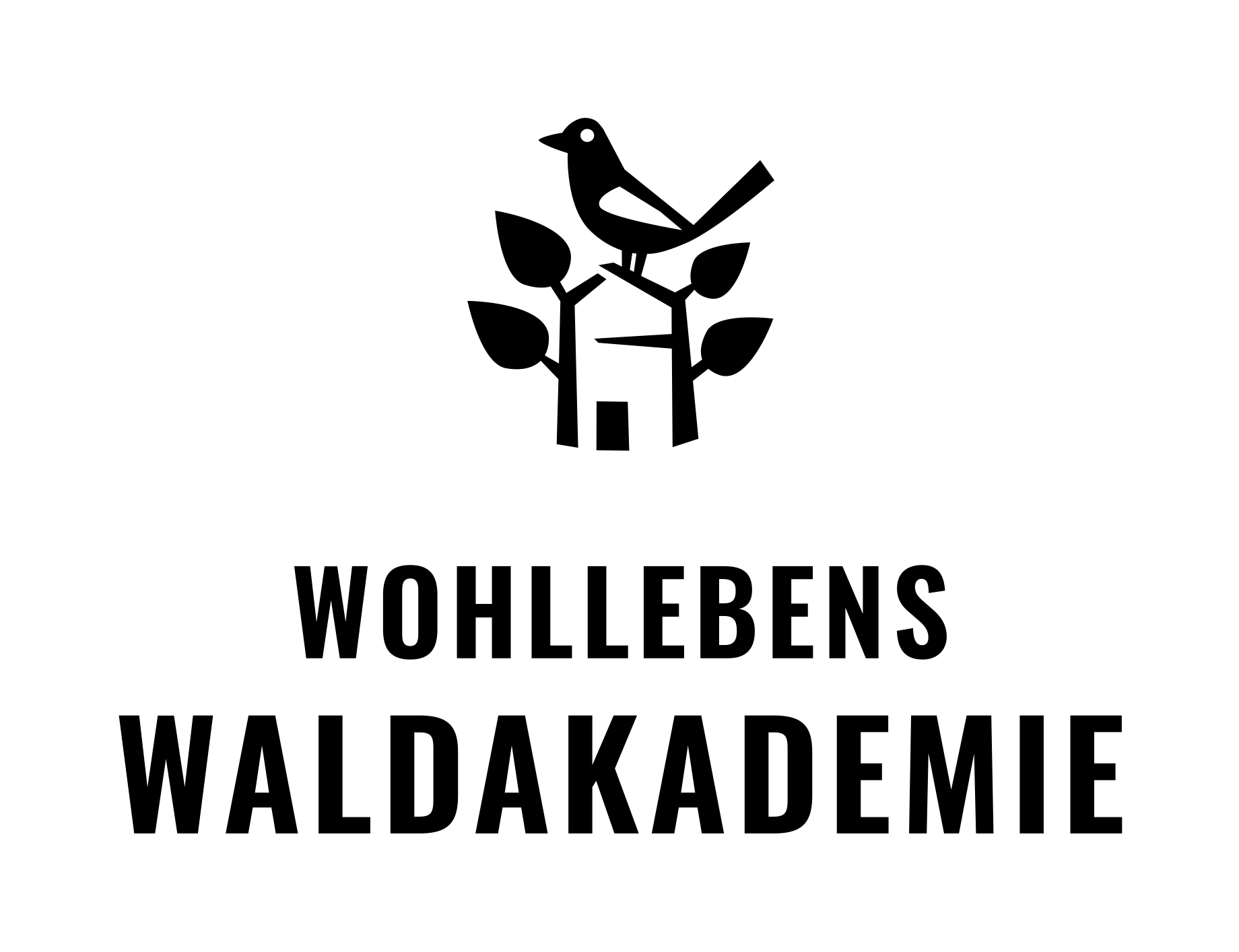
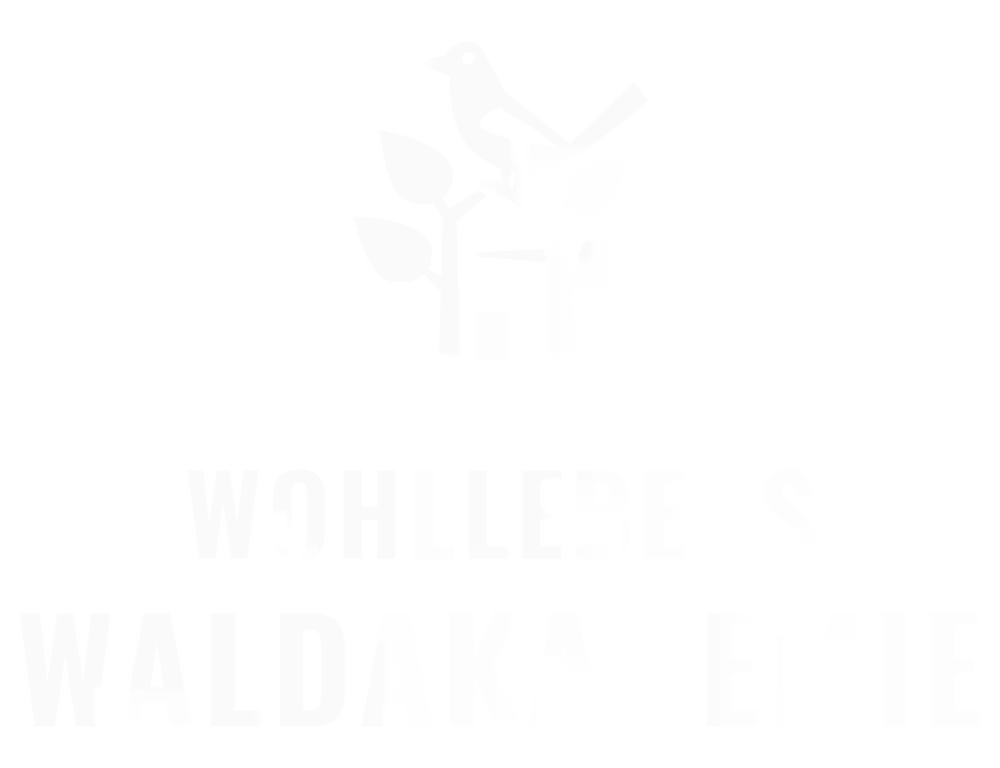





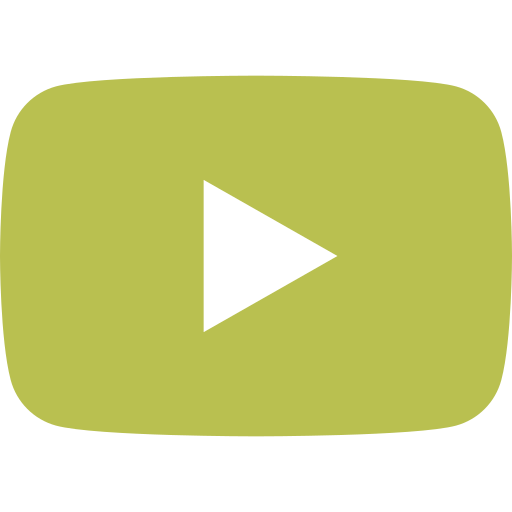




Hinterlasse einen Kommentar
Alle Kommentare werden vor der Veröffentlichung geprüft.
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.