Was sind Biosphärenreservate? Definition und Ziele
Biosphärenreservate gehören zu den großen Schutzgebietskategorien in Deutschland. Sie sind Teil eines weltweiten Programms der UNESCO, das seit den 1970er Jahren existiert. Ziel war und ist es, Modellregionen zu schaffen, in denen ökologische, soziale und ökonomische Entwicklung zusammengedacht werden.
Dabei orientiert sich das Programm auch an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen: Biosphärenreservate sollen beispielsweise dazu beitragen, das Leben an Land für alle Menschen zu verbessern oder den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Anders als in klassischen Naturschutzgebieten steht hier nicht der reine Ausschluss menschlicher Nutzung im Vordergrund, sondern die Frage: Wie kann nachhaltige Entwicklung in Einklang mit der Natur gelingen?
Zahlen und Fakten: Biosphärenreservate weltweit und in Deutschland
Weltweit gibt es 748 Biosphärenreservate in 134 Staaten. Rund 275 Millionen Menschen leben in diesen Regionen.
In Deutschland sind es derzeit 18 Biosphärenreservate, die zusammen etwa 4 % der Landesfläche einnehmen. Auch wenn sie offiziell als Netzwerk gelten, sind sie eher ein Flickenteppich – ähnlich wie schon bei den FFH-Gebieten und Natura 2000. Dennoch haben sie das Potenzial, eine wichtige Rolle bei den Nachhaltigkeitszielen bis 2030 einzunehmen.
Das Bundesnaturschutzgesetz bildet in Deutschland die Grundlage: Es definiert Biosphärenreservate als einheitlich zu schützende und zu entwickelnde Gebiete.
Zonenmodell: Kernzone, Pflegezone und Entwicklungszone erklärt
Um die Balance zwischen Schutz und Nutzung zu gestalten, sind alle Biosphärenreservate in drei Zonen unterteilt:
• Entwicklungszone: Hier steht die nachhaltige Nutzung im Vordergrund. Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder regionale Vermarktung – wie z. B. der Anbau alter Apfelsorten im Biosphärenreservat Rhön – sollen ökologisch und sozial verträglich gestaltet werden.
• Pflegezone: Bestimmte Kulturlandschaften, die für die biologische Vielfalt bedeutsam sind, werden gezielt gepflegt und gemanagt.
• Kernzone: Hier darf sich die Natur frei entwickeln, der Mensch hält sich zurück. Nutzung ist hier nicht vorgesehen – mit Ausnahme von Forschung, Monitoring und Bildungszwecken.
Die Kernzonen machen in Deutschland oft nur 3 bis maximal 4,5 % der Fläche eines Biosphärenreservats aus – ein sehr kleiner Anteil, gemessen an den Ambitionen des Programms.
Biosphärenreservat Rhön: Beispiel einer Modellregion
Das Biosphärenreservat Rhön erstreckt sich über drei Bundesländer: Hessen, Thüringen und Bayern. Es zeigt exemplarisch, wie Biosphärenreservate einerseits regionale Entwicklung fördern und andererseits wertvolle Lebensräume sichern sollen.
Wir hatten die Gelegenheit, uns mit dem Leiter des hessischen Teils, Herrn Raab, zu treffen und u.a. über die Chancen und Herausforderungen von Biosphärenreservaten gerade im Kontext des Naturschutzes zu sprechen. Das komplette Gespräch könnt ihr euch in diesem Video ansehen:
Kernzonen und das 10%-Schutzziel: Reicht der Beitrag der Biosphärenreservate?
Biosphärenreservate versprechen nachhaltige Nutzungsformen und sollen als Modellregionen vorangehen. Gleichzeitig zeigen sich hier aber auch Konfliktlinien: Selbst wo nachhaltige Nutzung gefördert werden soll, wird z.B. forstlich intensiv gearbeitet; so fanden wir in der Rhön Kahlschläge vor, die vorgeblich aufgrund einer Förderung von Niederwald stattgefunden hatten. Offiziell geschieht dies also aus naturschutzfachlichen Gründen – faktisch stehen ökologische und ökonomische Interessen oft eng nebeneinander.
Die Kernzonen tragen zwar zur Erreichung des 10%-Schutzziels bis 2030 bei, machen aber in den meisten Reservaten nur 3 bis 4,5 % der Fläche aus. Damit ist ihr Beitrag zur streng geschützten Gesamtfläche Deutschlands vergleichsweise gering. Zudem sind die Kernzonen oft isolierte „Patches“ – nicht zusammenhängende Wildnisgebiete. Für einen wirksamen Schutz von Biodiversität wäre eine größere, vernetzte Fläche nötig.
Fazit: Potenzial und Grenzen der UNESCO-Biosphärenreservate
Biosphärenreservate haben zweifellos großes Potenzial. Sie können nachhaltige Wirtschaftsformen voranbringen, regionale Entwicklung fördern und gleichzeitig wertvolle Rückzugsräume für die Natur sichern.
Doch die Kritik bleibt: Der Anteil echter Wildnis ist bislang zu klein, und selbst in diesen Modellregionen gibt es Beispiele, die kaum zum Leitbild der UNESCO passen. Damit ist klar: Biosphärenreservate sind ein wichtiger Baustein, aber sie allein werden nicht reichen, um die 10%-Schutzziele zu erreichen.
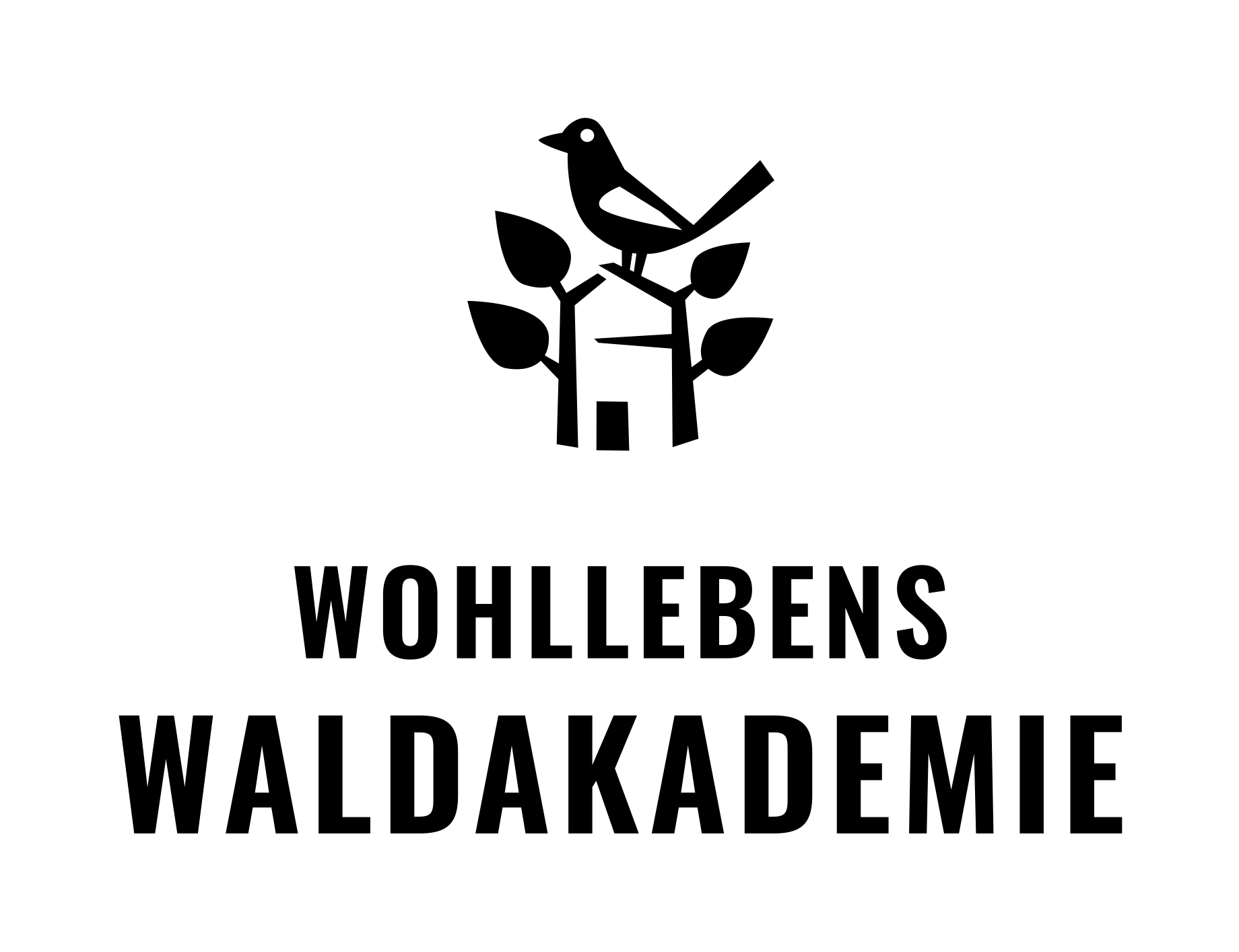
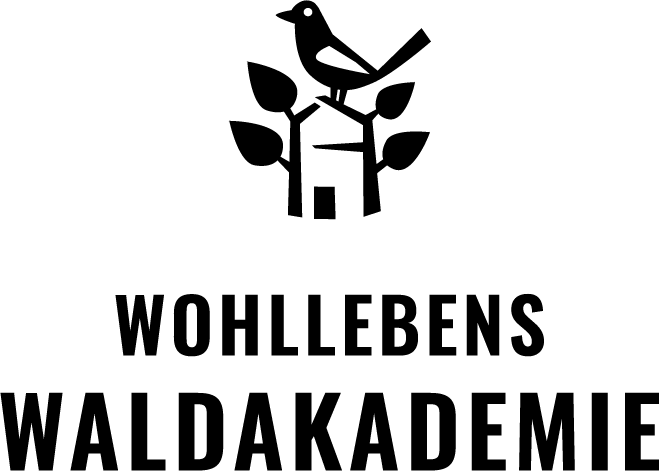




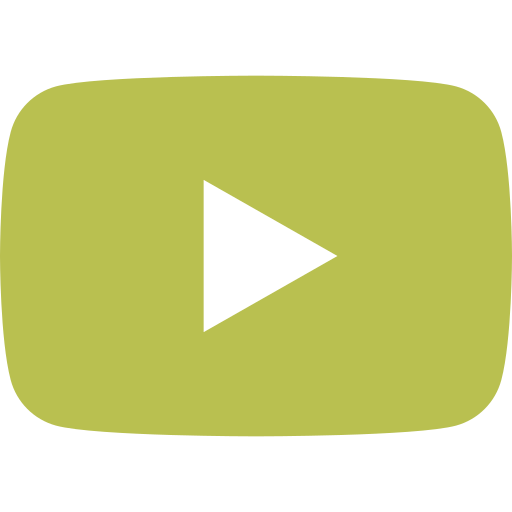


1 comment
Rainer Kirmse , Altenburg
UNSER WALD IN GEFAHR
Der Mensch macht sich die Erde Untertan,
getrieben vom ewigen Wachstumswahn.
Autos werden größer, Straßen breiter,
die Wälder dagegen schrumpfen weiter.
Vielen Tieren Lebensraum,
für den Sauerstoff ein Quell,
für gesundes Klima essenziell;
das ist unser Freund, der Baum.
Ohne Bäume in Wald und Flur
wär die Erde ein öder Planet nur.
Wir sehnen uns nach diesem Grün,
der Zeit, wenn wieder Bäume blüh’n.
Jeder Baum, der zum Opfer fällt,
macht etwas ärmer uns’re Welt.
Tornados, Hitze, Wassernot;
Feuer wüten in Wald und Flur.
Das Wetter gerät aus dem Lot,
Klimawandel zieht seine Spur.
Borkenkäfer in der Kiefer,
auch zur Fichte zieht Geziefer.
Statt sattes Grün und Waldeslust,
kranke Bäume und Försters Frust.
Profitgier lässt Wälder schwinden,
fördert weltweit Umweltsünden.
Die grüne Lunge des Planeten
in Gefahr, da hilft kein Beten.
Zu viele Buchen und Eichen
mussten schon der Kohle weichen.
Retten wir den herrlichen Wald,
bewahren die Artenvielfalt.
Kämpfen wir für Mutter Erde,
dass sie nicht zur Wüste werde.
Die Jagd nach ewigem Wachstum
bringt letztlich den Planeten um.
Das oberste Gebot der Zeit
muss heißen Nachhaltigkeit.
Statt nur nach Profit zu streben,
im Einklang mit der Natur leben.
Klima und Umwelt schützen, Raubbau beenden,
das Anthropozän zum Guten wenden.
Ökonomie und Ökologie im Verein,
der Blaue Planet wird uns dankbar sein.
Rainer Kirmse , Altenburg
Herzliche Grüße aus Thüringen
Leave a comment
All comments are moderated before being published.
This site is protected by hCaptcha and the hCaptcha Privacy Policy and Terms of Service apply.