Europas Antwort auf den Artenverlust
Natura 2000 ist das größte Schutzgebietsnetzwerk der Welt. Es besteht aus zwei Säulen: den Vogelschutzgebieten und den FFH-Gebieten (Flora-Fauna-Habitat). Der europäische Gedanke dahinter ist klar: Natur interessiert sich nicht für Landesgrenzen. Wenn wir Artenvielfalt wirklich erhalten wollen, müssen wir länderübergreifend denken und handeln.
Das Ziel: den dramatischen Biodiversitätsverlust aufhalten. Arten sollen dort geschützt werden, wo sie vorkommen, indem ihre wertvollsten Lebensräume erhalten bleiben. Im Fokus stehen dabei Leitarten, die für Europas Natur von besonderer Bedeutung sind – und bereits gefährdet. Beispiele sind die Bechsteinfledermaus, der Fischotter oder Pflanzen wie die Große Küchenschelle.
Trittsteinbiotope am Beispiel des Kranichs
Ein plastisches Beispiel, warum zusammenhängende Schutzgebiete so wichtig sind: Der Kranich brütet wieder in Deutschland – auch dank Natura 2000. Doch damit das funktioniert, müssen nicht nur die Überwinterungsgebiete in Spanien geschützt sein, sondern auch die Rastplätze entlang der Zugroute, wo die Vögel pausieren und Energie (auch in Form von Nahrung) tanken können. Nur wenn Kraniche überall geeignete Lebensräume finden, können sie ihre Reise bewältigen. Natura 2000 soll genau das ermöglichen – ein europäisches Netz von Schutzgebieten die, wenn schon nicht komplett zusammenhängend, zumindest in Form von Trittsteinbiotopen entlang der Reiserouten den Arten ein Überleben erlauben.
Keyfacts: Natura 2000 in Zahlen
- In Deutschland: ca. 5.200 Gebiete, auf 15,5 % der Landesfläche
- In der EU: rund 27.000 Gebiete, auf etwa 18,5 % der Landesfläche
- Damit bildet Natura 2000 das größte kooperative Naturschutzprojekt weltweit
Umsetzung in der Praxis: Welche Maßnahmen sollen den Schutz sicherstellen?
So viel zur grundsätzlichen Idee – schauen wir nun auf die Umsetzung. Wo befinden sich diese Gebiete eigentlich? Ursprünglich war der Gedanke, Lebensräume zu schützen, in denen noch wirklich Natur zu finden ist – idealerweise unberührte Wildnis. Doch in Europa, das dicht besiedelt und über Jahrhunderte intensiv genutzt wurde, gibt es nur wenige solcher Flächen. Deshalb richtet sich der Fokus zusätzlich auf Gebiete, in denen der Mensch zwar eingegriffen hat, die aber trotzdem noch naturnah sind und wertvollen Lebensraum bieten.
Dafür gelten zwei zentrale Schutzinstrumente:
1. Das allgemeine Verschlechterungsverbot:
Jede geplante Maßnahme – etwa ein Infrastrukturprojekt wie Straßen- oder Brückenbau – muss auf ihre Auswirkungen auf das Schutzgebiet geprüft werden. Fällt diese Prüfung negativ aus, ist das Vorhaben im Zweifel zu untersagen.
2. Aktive Erhaltungsmaßnahmen bei Bedarf:
Manche Lebensräume würden ohne menschliches Eingreifen verschwinden. Eine Wacholderheide etwa würde nach und nach von Wald überwachsen. Um solche Lebensräume abseits ihrer natürlichen Verbreitung zu erhalten, braucht es Mahd- oder Weidemanagement. Auch eine Belastung mit Pestiziden ist zu vermeiden. Für jedes FFH-Gebiet gibt es deshalb einen eigenen Managementplan – außer bei Gebieten mit unberührter Wildnis, die sich selbst regulieren.
Kein schlechter Gedanke – aber es gibt einen großen Haken.
Der Haken: Wenn Schutz nur auf dem Papier steht
Ein anschauliches Beispiel sind die Buchenwälder, die wir schon im letzten Artikel zu Naturschutzgebieten behandelt haben. Die wertvollen alten Bäume sind großflächig verschwunden und durch Jungwuchs ersetzt. Wie passt das mit dem Verschlechterungsverbot und den Maßnahmenkonzepten zusammen? Offensichtlich: Es ist eine deutliche Verschlechterung.
Wer einen Blick ins schriftliche Sofortmaßnahmenkonzept wirft, erkennt auf den ersten Blick durchaus sinnvolle Absichten – der Teufel steckt aber im Detail. Dort heißt es etwa: „dauerwaldartige Strukturen werden angestrebt“ oder „Totholz sollte im Wald belassen werden“. Kein Muss, keine konkreten Mengen. In den 120-jährigen Beständen sind einheitlich nur fünf Bäume pro Hektar zum Erhalt geplant. Das sind vier alte Bäume auf einem Fußballfeld! Was hat das mit Wald zu tun? Die Folge: Für Totholzbewohner, Fledermäuse, Spechte oder Käfer, die ein kühles, feuchtes Waldinnenklima benötigen, ist der Lebensraum verloren. Der Bestand wird stark erwärmt, Waldökosysteme gehen verloren. Faktisch wird die 120-jährige Waldentwicklung auf Null zurückgesetzt. Hier findet ordnungsgemäße Forstwirtschaft statt – in einem Schutzgebiet.
Auch die Rechtsprechung bestätigt: Präzedenzfälle wie der als FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet ausgewiesene Stadtwald Leipzig zeigen, dass solche Maßnahmen grundsätzlich zwar erlaubt sein können – aber nicht, wenn sie zu deutlicher Verschlechterung führen, womit gegen das EU-Recht verstoßen würde. Eine vorherige Verträglichkeitsprüfung ist daher notwendig.
Flickenteppich oder Erfolgsmodell?
Natura 2000 ist ein Meilenstein des europäischen Naturschutzes. Es ist ein gemeinsames Projekt, das Natur über Grenzen hinweg denkt – ein Fortschritt gegenüber rein nationalem Schutz.
Doch es bleibt ein Flickenteppich in Form einzelner Trittsteinbiotope statt einer zusammenhängenden Fläche. Schlimmer noch: Manche Gebiete sind gut gemanagt, viele aber leiden unter schwachen Formulierungen und zu großzügigen Ausnahmen für Land- und Forstwirtschaft.
Fazit: Zählen Natura 2000-Gebiete zu den „10 % streng geschützten Flächen“?
Die EU-Biodiversitätsstrategie fordert 10 % streng geschützte Flächen. Ob Natura 2000-Gebiete dazugehören, ist fraglich: Manche erfüllen die Kriterien, viele aber nicht. Wie schon bei klassischen Naturschutzgebieten gilt: Es gibt gute und schlechte Beispiele. Sie pauschal mitzuzählen wäre irreführend – genaues Hinsehen bleibt Pflicht. Wir suchen weiter.
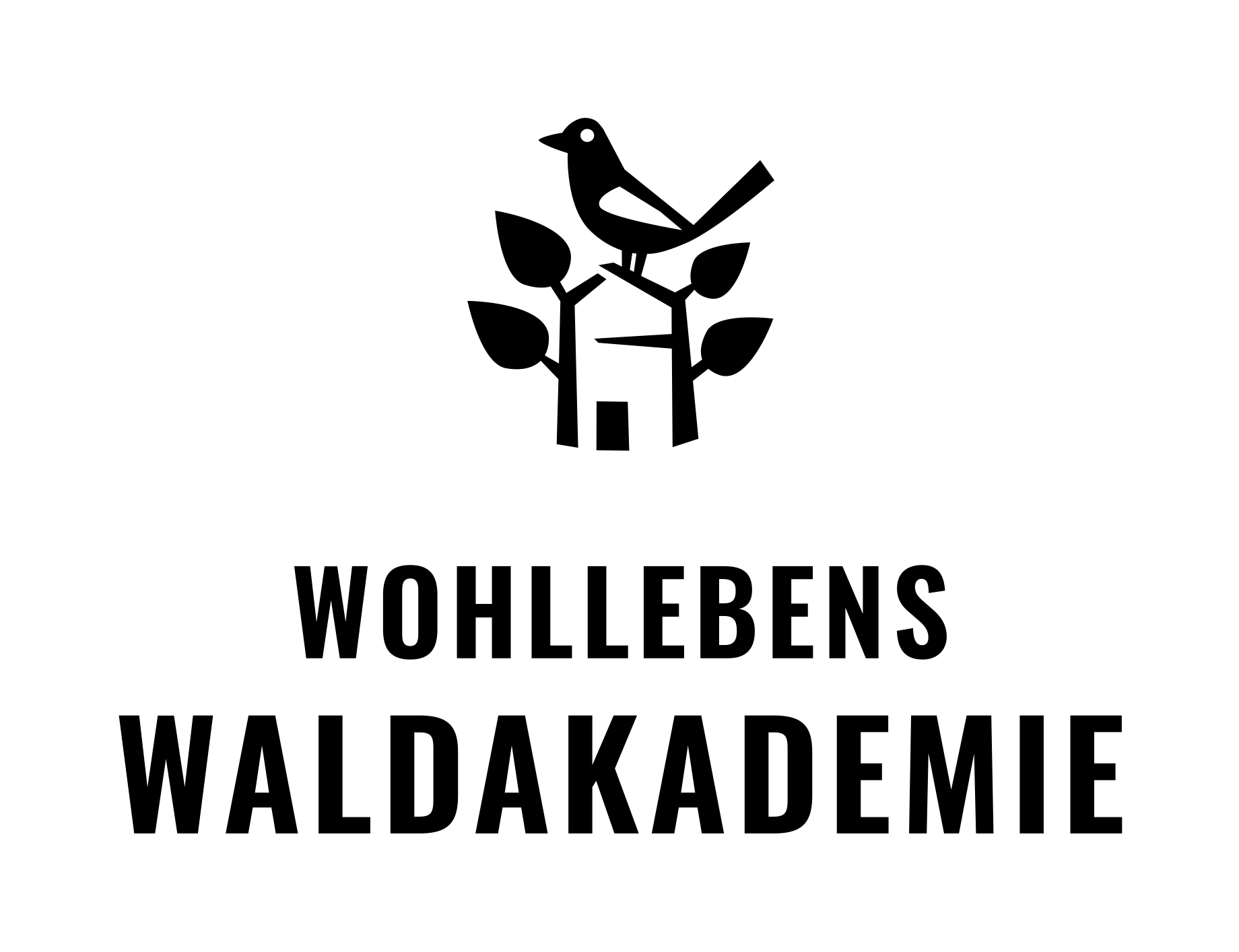
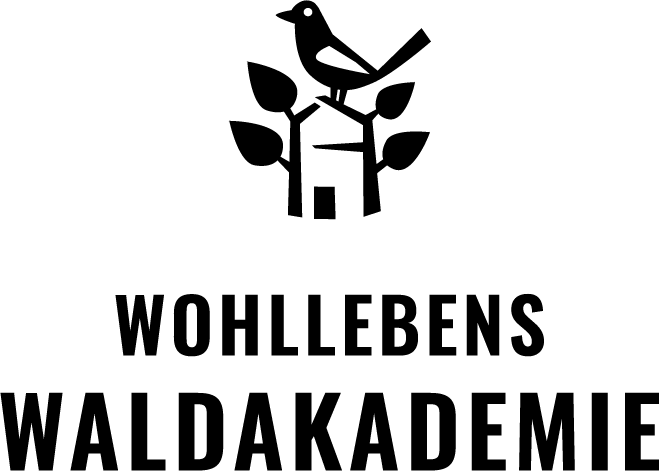




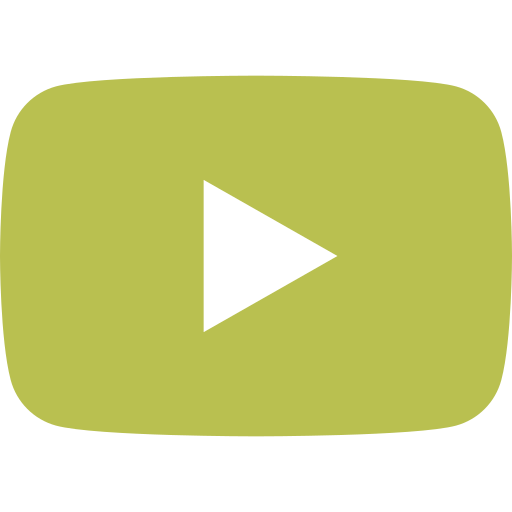



Leave a comment
All comments are moderated before being published.
This site is protected by hCaptcha and the hCaptcha Privacy Policy and Terms of Service apply.